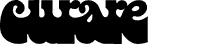Zusammenfassung
- Was Call For Papers — Special Issue Curare
- Wann to (Europe/Berlin / UTC100)
- URL https://curarejournal.org/ojs/index.php/cur/index
- Termin herunterladen iCal Datei herunterladen
Beschreibung
CfP: Curare - Journal of Medical Anthropology
Special Issue: Abortion and Miscarriage: Narratives, Practices, Discourses
Frist: 2025-12-15
URL: http://www.curarejournal.org
(Guest Editor: Dr. Florian Lützelberger, Otto-Friedrich-Universität Bamberg/University of Oxford)
- English version below -
Abtreibung und Fehlgeburt: Narrative, Praktiken, DiskurseIn
La condition fœtale (2004) beschreibt Luc Boltanski die Ambivalenz, die die kulturellen und gesellschaftlichen Umgangsweisen mit dem Fötus prägt: Er erscheint zugleich als unsichtbares medizinisches Objekt, als Projektionsfläche sozialer Erwartungen, als rechtlich normiertes Leben im Werden und als intimes Geheimnis. Diese Gleichzeitigkeit des Sichtbaren und Unsichtbaren, des Privaten und Politischen, der Körpererfahrung und der gesellschaftlichen Zuschreibung strukturiert in besonderer Weise auch die Erzählungen und Praktiken rund um Schwangerschaftsabbruch und Fehlgeburt. Damit ist der Fötus nicht nur ein Grenzfall individueller Erfahrung, sondern auch ein paradigmatisches Objekt biopolitischer Regulierung im foucaultschen Sinn: An ihm verdichten sich Diskurse, die über Leben, Körper und Bevölkerung verfügen und so normative Ordnungen von Sexualität und Reproduktion herstellen. Zugleich eröffnet sich ein Spannungsfeld, in dem unterschiedliche Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten aufeinandertreffen: Während juristische und medizinische Diskurse den Fötus in Normen und Kategorien fassen, entstehen in autobiographischen, literarischen oder künstlerischen Darstellungen Räume, die sich der hegemonialen Logik entziehen. In diesem Sinne lassen sich viele Narrative über Abtreibung und Fehlgeburt auch als Formen dessen verstehen, was Lauren Berlant (2008) als counterpublics beschrieben hat: kommunikative Räume, in denen marginalisierte Erfahrungen artikuliert und gegen dominante moralische und politische Ordnungen in Stellung gebracht werden. Schwangerschaftsabbruch und Schwangerschaftsverlust erscheinen so nicht nur als medizinisch-rechtliche Fragen oder individuelle Schicksale, sondern als Schnittstellen, an denen sich Konflikte um Sichtbarkeit, Anerkennung und die Deutungshoheit über den gebärenden Körper verdichten.
Die gegenwärtigen Debatten um Abtreibung und Schwangerschaftsverlust zeigen die Dringlichkeit des Themas: die Rücknahme von Roe v. Wade in den USA, die Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die französische Verfassung im Jahr 2023, aber auch die anhaltenden Kontroversen um die personhood des Embryos und die Regulierung von Reproduktion. Gleichzeitig sind es nicht nur juristisch-politische Auseinandersetzungen, die das Feld prägen, sondern auch literarische, künstlerische und autobiographische Zeugnisse. Das inzwischen vielleicht prominenteste Beispiel ist Annie Ernaux’ L’événement (2000), das in seiner kompromisslosen Nüchternheit ein zentrales Dokument feministischer Literaturgeschichte darstellt. Zugleich verdeutlicht der Text paradigmatisch, wie literarische Sprache Erfahrungen des Abbruchs und deren gesellschaftliche Verurteilung sichtbar macht und dabei die starke Individualität und Subjektivität solcher Erfahrungen prägnant hervorhebt.
Das geplante Themenheft möchte die Interferenzen und Spannungen zwischen Körper, Medizin, Recht, Ethik, Gesellschaft und Subjektivität in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch und Fehlgeburt in den Blick nehmen. Dabei sollen unterschiedliche zeitliche, kulturelle und soziale Kontexte berücksichtigt werden. Das Heft versteht sich als Plattform für eine interdisziplinäre Diskussion, die die lange medizinhistorische und anthropologische Dimension von Abtreibung und Fehlgeburt ebenso ernst nimmt wie deren aktuelle literarische, künstlerische und politische Aushandlungen. Ziel ist es, ein Panorama von Zugängen zu eröffnen, das die Schnittstellen von Körper, Wissen, Normen, Praktiken und Erfahrung in diesem hochsensiblen Feld sichtbar macht.
Wir laden Beiträge aus allen relevanten Disziplinen ein – unter anderem der Sozial- und Kulturanthropologie, Empirischen Kulturwissenschaft, Medizingeschichte, Medienwissenschaft, Soziologie, Hebammenwissenschaft, Humanmedizin, Rechts- und Geschichtswissenschaft, Literatur- und Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, Filmwissenschaft, Philosophie und Ethik, Gender Studies sowie den Medical/Health Humanities. Dabei sind auch interdisziplinäre Zugänge willkommen.
Beiträger*innen könnten sich u. a. mit folgenden Perspektiven auseinandersetzen – oder aber ganz eigenen Fragestellungen entwickeln und eigens gewählten Kontexten nachgehen:
- Praktiken und Körperlichkeiten:
Wie gestalten sich alltägliche Praktiken, Rituale und symbolische Ordnungen rund um Abbruch und Fehlgeburt? Welche Rolle spielen Hebammen, Ärzt*innen, Engelmacher*innen, Heiler*innen, religiöse Akteure, Familien und Gemeinschaften? Welche transkulturellen Vergleiche lassen sich ziehen – etwa zwischen lokalen Wissenssystemen, biomedizinischen Diskursen und global health-Programmen? - Narrative und Repräsentationen:
Wie werden Abtreibung und Fehlgeburt in literarischen Texten, autobiographischen und autofiktionalen Erzählungen, künstlerischen Arbeiten, Filmen, digitalen Medien oder performativen Praktiken dargestellt? Welche Metaphern, ästhetischen Verfahren und Narrative von Scham, Schmerz, Schweigen oder Widerstand strukturieren diese Darstellungen? - Historische und gesellschaftliche Dimensionen:
Welche historischen Praktiken – von traditionellen Hausmitteln bis zu modernen gynäkologischen Verfahren – lassen sich rekonstruieren? Wie spiegeln sich rechtliche, medizinische oder religiöse Normierungen in individuellen und kollektiven Umgangsweisen wider? Welche Sichtbarkeits- und Unsichtbarkeitsregime prägen Diskurse über Abbruch und Fehlgeburt in unterschiedlichen Epochen und Kulturen? - Theoretische Reflexionen:
Wie helfen soziologische, anthropologische, kulturwissenschaftliche oder feministische Konzepte (etwa bei Boltanski, Illouz, Berlant) beim Verständnis von Reproduktion, Körper, Mutterschaft, Subjektivität und Geschlecht? Wie lassen sich intersektionale Perspektiven (Gender, Klasse, Race, Alter, Behinderung, Religion) produktiv einbinden? - Affekt, Erinnerung, Verwandtschaft:
Welche Formen von Trauer, Gedenken oder genealogischer Neuordnung entstehen im Zusammenhang mit Abbruch oder Fehlgeburt? Wie wirken diese Erfahrungen in individuelle Biographien, kollektive Erinnerungen und Verwandtschaftsstrukturen hinein?
Zeitplan und Einreichung:
- Abstracts (ca. 350 Wörter zzgl. Literaturangaben sowie kurze bio-bibliographische Angaben; Beitragssprachen: Deutsch und Englisch) bis 15. Dezember 2025 an: florian.luetzelberger[ at ]uni-bamberg.de
- Rückmeldung über die Annahme während der Winterpause
- Einreichung der vollständigen Beiträge bis 1. Juni 2026
- Peer-Review-Verfahren und Überarbeitungen über den Sommer
- Geplantes Erscheinen des Themenhefts im Herbst/Winter 2026
Die Zeitschrift Curare bietet seit 1978 ein internationales und interdisziplinäres Forum für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit medizinanthropologischen Themen, die sämtliche Aspekte von Gesundheit, Krankheit, Medizin und Heilung in Vergangenheit und Gegenwart in allen Teilen der Welt umschließt. Beiträge werden auf Deutsch und Englisch veröffentlicht und einem doppelblinden Peer Review-Verfahren unterzogen. Curare erscheint open access unter www.curarejournal.org, die Druckversion im Reimer Verlag Berlin.
English version:
Abortion and Miscarriage: Narratives, Practices, Discourses
In La condition fœtale (2004), Luc Boltanski describes the profound ambivalence that shapes cultural and social modes of engaging with the foetus: it appears at once as an invisible medical object, as a projection surface for social expectations, as a legally regulated life in the making, and as an intimate secret. This simultaneity of the visible and the invisible, the private and the political, embodied experience and social attribution, profoundly structures the narratives and practices surrounding abortion and miscarriage. The foetus thus emerges not only as a borderline case of individual experience but also as a paradigmatic object of biopolitical regulation in the Foucauldian sense: it condenses discourses that seek to govern life, bodies, and populations, thereby establishing normative orders of sexuality and reproduction. At the same time, a contested field opens up in which different publics and counterpublics intersect. While legal and medical discourses seek to capture the foetus within norms and categories, autobiographical, literary, or artistic representations generate spaces that elude hegemonial logic. In this respect, many narratives of abortion and miscarriage can also be understood as forms of what Lauren Berlant (2008) has termed counterpublics: communicative arenas in which marginalised experiences are articulated and positioned against dominant moral and political orders. Abortion and pregnancy loss thus appear not only as medico-legal issues or individual fates but as crucial sites where conflicts over visibility, recognition, and interpretive authority with regard to the childbearing body become condensed.
Contemporary debates underscore the urgency of the subject: the overturning of Roe v. Wade in the United States, the enshrinement of the right to abortion in the French Constitution in 2023, as well as ongoing controversies concerning the personhood of the embryo and the regulation of reproduction. Yet the field is shaped not only by juridical and political disputes but also by literary, artistic, and autobiographical testimony. Perhaps the most prominent example is Annie Ernaux’s L’événement (2000), which has become a central document of feminist literary history. Ernaux’s text demonstrates paradigmatically how literary language renders visible both the lived experience of abortion and its social condemnation, while simultaneously highlighting the individuality and subjectivity of such experiences.
The planned special issue seeks to examine the interferences and tensions between body, medicine, law, ethics, society, and subjectivity in relation to abortion and miscarriage, while taking into account a wide range of temporal, cultural, and social contexts. This issue positions itself as a platform for interdisciplinary dialogue that takes seriously both the long medical-historical and anthropological dimensions of abortion and miscarriage and their contemporary literary, artistic, and political articulations. Its aim is to open up a wide panorama of approaches that makes visible the intersections of body, knowledge, norms, practices, and lived experience within this highly sensitive field.
We invite contributions from all relevant disciplines, including social and cultural anthropology, empirical cultural studies, history of medicine, media studies, sociology, midwifery studies, medicine, law, history, literary and cultural studies, art history, film studies, philosophy and ethics, gender studies, and the medical and health humanities. Interdisciplinary approaches are particularly welcome.
Contributors might, for instance, engage with the following perspectives – or pursue their own questions in contexts of their choice:
- Practices and corporealities:
How are everyday practices, rituals, and symbolic orders around abortion and miscarriage shaped? What roles do midwives, physicians, “backstreet” providers, healers, religious actors, families, and communities play? What transcultural comparisons can be drawn – for example, between local knowledge systems, biomedical discourses, and global health programmes? - Narratives and representations:
How are abortion and miscarriage represented in literary texts, autobiographical and autofictional accounts, artistic works, films, digital media, or performative practices? What metaphors, aesthetic strategies, and narrative patterns of shame, pain, silence, or resistance structure these representations? - Historical and social dimensions:
What historical practices – from household remedies to modern gynaecological procedures – can be reconstructed? How are legal, medical, or religious regulations reflected in individual and collective responses? What regimes of visibility and invisibility govern discourses about abortion and miscarriage across different epochs and cultures? - Theoretical reflections:
How might sociological, anthropological, cultural, or feminist concepts (for instance, Boltanski, Illouz, Berlant) contribute to an understanding of reproduction, the body, motherhood, subjectivity, and gender? How can intersectional perspectives (gender, class, race, age, disability, religion) be productively incorporated? - Affect, memory, kinship:
What forms of mourning, commemoration, or genealogical connections emerge in the context of abortion and miscarriage? How do such experiences enter into dialogue with individual biographies, collective memories, and kinship structures?
Timeline and submission
Abstracts (approx. 350 words plus references and a short biobibliographical note; languages of submission: German and English) should be sent by 15 December 2025 to: florian.luetzelberger[ at ]uni-bamberg.de
- Notification of acceptance during the winter break
- Full papers due by 1 June 2026
- Peer review and revisions over the summer
- Publication of the special issue planned for autumn/winter 2026
Since 1978, Curare journal has provided an international and interdisciplinary forum for scientific debate on medical anthropological topics, covering all aspects of health, illness, medicine and healing in the past and present in all parts of the world. Contributions are published in German and English and undergo a double-blind peer review process. Curare is published open access at http://www.curarejournal.org, with the print version published by Reimer Verlag Berlin
Kontakt
Dokumente senden an
Dr. Florian Lützelberger
florian.luetzelberger[ at ]uni-bamberg.de