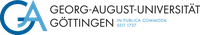Zusammenfassung
- Was Stipendium — Fellowships zur Erforschung von „Komplexität als Thema des Rechts“
- Wann to (Europe/Berlin / UTC200)
- Wo Frankfurt/Main — Deutschland
- URL https://uni-goettingen.de/de/document/download/77168ed4bf600c782bc2646ee649983c.pdf/Call%20for%20Applications_Komplexit%C3%A4t%20Recht.pdf
- Termin herunterladen iCal Datei herunterladen
Beschreibung
Call for Applications
Fellowships zur Erforschung von „Komplexität als Thema des Rechts“
im Rahmen des Projekts „Wandel im und durch Recht – Digitale Transformation und Klimawende“
Wir laden Forschende aller Disziplinen und Karrierestufen ein, sich im Jahr 2026 als Fellows mit eigenen Forschungsvorhaben an unserem Projekt zu beteiligen.
Forschungsperspektive
Komplexität, als charakteristisches Merkmal von Transformationsprozessen, entsteht durch eine nicht überschaubare Zahl sich wechselseitig beeinflussender Faktoren. In der Folge lassen sich komplexe Zusammenhänge nicht gleichzeitig ganzheitlich und feingranular beschreiben. Die Forschung differenziert sich vielmehr bei der Untersuchung komplexer Gegenstände in unterschiedliche Zugänge verschiedener Disziplinen aus. Für das Recht, verstanden als Gesetzgeber, Behörden, Justiz und private Rechtsanwender*innen sowie Rechtswissenschaft, folgen hieraus spezifische Herausforderungen: Die digitale Transformation und die Klimawende konfrontieren das Recht mit neuen Regelungsbedarfen und der Notwendigkeit, bestehende Regelungsstrukturen an sich wandelnde Realitäten anzupassen. Zugleich können normative Entscheidungen und Regelungen nur gelingen, wenn komplexe Wirklichkeiten angemessen verstanden und verarbeitet werden.
Anliegen des Projekts „Wandel im und durch Recht – Digitale Transformation und Klimawende“ ist, die normative Relevanz und die Gelingensbedingungen angemessener Beschreibungen komplexer Wirklichkeit zu erörtern. Als Analysefolie dienen dabei die digitale Transformation sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Folgen.
Aus einer grundlegenden Perspektive stellt sich die Frage, was ein angemessenes Verständnis der Regelungsbereiche für die Zwecke des Rechts ausmacht. Ein weiterer Fragenkreis betrifft die Verarbeitung außerrechtlicher Beschreibungen im Recht, zumal sich in Transformationsprozessen Recht und Wirklichkeit gegenseitig beeinflussen. In diesem Kontext liegt beispielsweise eine normativ kaum vorstrukturierte Funktion des Rechts darin, gesellschaftliche Prozesse komplexer Selbstorganisation zu rahmen. Außerdem bringt der Umgang mit Komplexität für das Recht dadurch Herausforderungen mit sich, dass Entwicklungen nur eingeschränkt planbar oder auch nur vorhersehbar und entsprechend auch nur in jeweils bestimmter Hinsicht gestaltbar sind.
Die konkreten normativen Anforderungen an den Umgang mit Komplexität unterscheiden sich je nach Akteur*in. So stellt sich für die Gesetzgebung die Frage, welche verfassungsrechtlichen Anforderungen, etwa aus dem Demokratieprinzip oder aus den Grundrechten, an die Wissensgrundlage bestehen. Eine Facette dieser normativen Anforderungen bildet das Verhältnis von Expert*innen-Wissen zu politischer Verantwortung. Bezogen auf Behörden und Gerichte, aber auch auf sonstige Akteur*innen, hängt die Anknüpfung an Wirklichkeitsbeschreibungen anderer Disziplinen in der Rechtsanwendung wesentlich davon ab, inwiefern die Auswahl von Wissensbeständen unterschiedlicher Disziplinen normativ vorstrukturiert ist oder anderen Kriterien der situativen oder kontextübergreifenden Angemessenheit folgt. Fragen der Fortentwicklung des Rechts im Transformationsprozess werden an der Entwicklung neuer Rechtsinstitute in Rechtsprechung oder Gesetzgebung deutlich, etwa der Einführung neuer Ausschließlichkeitsrechte oder der Anerkennung neuer Formen der Rechtsträgerschaft, beispielsweise von Rechten der Natur, Rechten zukünftiger Generationen, Rechten an Daten oder der Rechtsfähigkeit digitaler Agenten oder kollektiver Phänomene im digitalen Raum.
In diesen Zusammenhängen setzt das Recht die Angemessenheit des Verständnisses komplexer Wirklichkeit als selbstverständlich voraus. Es entwickelt dabei allerdings keine methodischen Kriterien im Umgang mit unterschiedlichen Wirklichkeitsbeschreibungen, obwohl gerade der Auswahl spezifischer und der Synthese verschiedener Wissensperspektiven für die Rolle des Rechts in Transformationsprozessen große Bedeutung zukommen kann. So kann sich etwa der Akzent rechtlicher Handlungs- und Regulierungsbedarfe unter Umständen erheblich verschieben, je nachdem, an welche Disziplin(en) bei der Rezeption von Wissensbeständen über Phänomene der Wirklichkeit angeknüpft wird.
Es fragt sich daher beispielsweise:
- Welche Methoden oder Kriterien lassen sich, auch aus der Perspektive anderer Disziplinen, für die Angemessenheit des Verständnisses eines Lebensbereiches formulieren?
- Wie wird in politischen oder administrativen Prozessen Wissen über komplexe Sachverhalte selektiert, vermittelt und rechtlich relevant?
- Wie verändert sich staatliche Steuerungsfähigkeit unter Bedingungen von komplexen gesellschaftlichen Transformationsprozessen?
- Wie werden verstreute und komplex strukturierte Wissensbestände für regulatorische Prozesse zusammengeführt und aufbereitet?
- Welche epistemischen Grenzen bestehen dabei aus Sicht der jeweiligen Fachcommunities?
Adressat*innen und Rahmenbedingungen
Der disziplinär offene Call for Applications richtet sich an Forschende aus allen Stadien der wissenschaftlichen Karriere (einschließlich Promovierender und Postdocs), die Interesse haben, im Austausch mit den Projektbeteiligten in Anknüpfung an die Projektperspektiven zu forschen und sich in die Abschlusskonferenz einzubringen. Die Ergebnisse der Fellows werden im Rahmen einer Abschlusskonferenz am 12./13. November 2026 in Frankfurt a. M. präsentiert und gemeinsam in einer angesehenen Zeitschrift oder Schriftenreihe veröffentlicht.
Die Fellowships sind im Grundsatz auf einen Zeitraum von einem Monat bis zu drei Monaten im Jahr 2026 an einem der beteiligten Standorte (Göttingen/Berlin, Halle (Saale) und Frankfurt a. M.) – abhängig von der inhaltlichen Ausrichtung – ausgelegt. Abweichende Zeiträume sind möglich. Angemessene Reise- und Unterbringungskosten werden übernommen.
Bewerbung
Wenn Sie sich an unserem Gemeinschaftsprojekt beteiligen möchten, reichen Sie bitte bis zum 15. November 2025 Ihre Bewerbung (Darstellung des Forschungsvorhabens auf max. drei Seiten; Lebenslauf; ggf. einschlägige Publikationen und Vorarbeiten; Präferenzen zu Zeitraum, Dauer und Standort) per E-Mail unter komplexitaetsfellows[ at ]jur.uni-frankfurt.de ein. Bewerbungen werden laufend entgegengenommen und geprüft. Eine Vergabe kann bereits vor Ablauf der Frist erfolgen.
Für Rückfragen oder einen kurzen Austausch stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Roland Broemel, Goethe-Universität Frankfurt am Main, broemel[ at ]jur.uni-frankfurt.de
Mareike Schmidt, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, mschmidt[ at ]eth.mpg.de
Angela Schwerdtfeger, Georg-August-Universität Göttingen, angela.schwerdtfeger[ at ]jura.unigoettingen.de
Gefördert von der VolkswagenStiftung
Kontakt
Dokumente senden an
komplexitaetsfellows[ at ]jur.uni-frankfurt.de